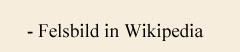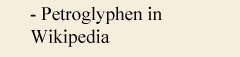Bei den Bubalussen von El Ghicha.
Felsbilder in der algerischen Sahara. 1990
Felsbilder in der algerischen Sahara. 1990
Lascaux kennt jeder, die berühmte Höhle mit den Malereien im französischen Département Dordogne. Altamira in Spanien ist vermutlich ebenfalls den meisten bekannt - die Geschichte von der fünfjährigen Maria, die den Vater in die Höhle begleitet, den Blick zur Decke richtet und ausruft: "Papa, mira toros pintados!" (Schau Papa, die gemalten Stiere!) Viele Jahrtausende sind diese Bilder alt. Über die Menschen, die sie auf Felswände malten oder in den Stein ritzten, weiß man wenig. Auch über die Gründe, die sie dazu veranlassten, kann man nur spekulieren. Aber man weiß, dass diese Darstellungen nicht die einzigen sind, dass sie vielmehr zu einer fast unendlichen Menge vergleichbarer Bilder gehören, viele davon in Frankreich und Spanien, viele auch in anderen Teilen der Welt. Abbildungen von Menschen und Tieren, von Häusern und Booten und von Symbolen aller Art finden sich überall - im schwedischen Tanum ebenso wie im norditalienischen Valcamonica, in der Apollo-11-Höhle in Namibia, im Petrified-Forest-Nationalpark in den USA und in der Kalksteinhöhle Ile Kére Kére im südostasiatischen Osttimor. Und man findet sie in der Sahara.

Der Kalender zeigt den 1. Januar 1990, und es ist kalt. Während der Nacht ist das Thermometer unter Null gefallen, und wir haben uns tief in unsere Schlafsäcke verkrochen. Wie bereits etliche Nächte zuvor, haben wir auch die letzte in unserem VW-Bus verbracht, einige Dutzend Kilometer von Aflou entfernt, einer Stadt im Norden der algerischen Sahara. Auf einen morgendlichen Kaffee verzichten wir, denn den hätten wir draußen kochen müssen, und draußen ist es außer kalt auch noch windig, feucht und leicht neblig - alles das, was man sich unter dem Stichwort Wüste eher nicht vorstellt. Schnell ein paar Kekse, ein Schluck Wasser, dann fahren wir los. Bis zur Oase El Ghicha sind es nur wenige Kilometer, doch da die Straße in schlechtem Zustand ist, brauchen wir einige Zeit. Rund 6.000 Einwohner zählt der Ort, von denen zu dieser frühen Stunde bereits viele auf den Beinen sind. Ein Mann kommt uns entgegen. Er ist eingehüllt in einen wärmenden Burnus, über den Kopf hat er eine Kapuze gezogen, die nicht mehr als Augen und Nase frei lässt. Klar, dass er weiß, was wir wollen, denn warum sonst kämen zwei Touristen mit einem VW-Bus in seinen Ort! Entsprechend bedarf es keiner langen Konversation, nur eines Aushandelns des Preises, über den wir uns schnell einig sind. Karin wechselt vom Beifahrersitz in den hinteren Teil des Wagens, wo wir auf selbstgebauten Holzkisten inmitten aufgestapelten Gepäcks nachts unsere Schlafstatt einrichten. Da die Liegematten nicht aufgeblasen und die Schlafsäcke verstaut sind, ist es dort hart und unbequem, aber unser Führer ist nun mal ein Mann, Karin dagegen "nur" eine Frau. Was spielt es da für eine Rolle, dass das Fahrzeug auf ihren Namen zugelassen ist ... Der Führer deutet mit dem Finger in eine Richtung, und wir verlassen den Ort. Wenig später biegen wir auf einen Hangweg ein, der in abenteuerlichem Verlauf in ein Tal führt, immer hart am Abgrund entlang, über Steine und Felsen, durch ein Flüsschen hindurch und auf der anderen Seite abermals über Steine und Felsen. Also genau die Strecke, die wir zu Hause mit einem solchen Auto gewiss nicht fahren würden. Nach den Maßstäben der Sahara könnte man die Gegend, durch die wir kommen, als fruchtbar bezeichnen. Menschen lebten hier auch schon in früheren Zeiten, etwa die Römer, von deren Anwesenheit die Reste eines Aquäduks und einer Mühle zeugen oder die Berber, die diesen Landstrich noch heute bewohnen. An die zeitweise Anwesenheit französischer Fremdenlegionäre erinnern einige halbzerfallene Forts.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Als der Weg schlechter wird, lässt unser Führer uns anhalten. Den Rest der Strecke müssten wir laufen, erklärt er und lässt sich von dem weichen Vordersitz herab. Karin massiert derweil ihre Glieder. Eine Ziegenherde kommt uns entgegen, der Hirte grüßt mit einem Nicken, wir grüßen zurück. Erstaunt, uns zu treffen, ist er nicht, denn natürlich weiß auch er, warum wir hier sind. Alle Einheimischen wissen das, aber alle hüten das Geheimnis, weshalb es weder Hinweisschilder noch Wegbeschreibungen gibt. Wer hierher kommt, der soll sich einen Führer nehmen, denn ein Führer bedeutet Arbeit, und die können die Menschen in einem Land mit hoher Arbeitslosigkeit nur allzu gut brauchen. Nachdem wir eine Weile gegangen sind, deutet unser Begleiter auf eine Felswand. Wir folgen einem Pfad durch ein steinernes Labyrinth, und dann stehen wir auf einmal vor jenen Bildern, um deretwillen wir hier sind - Bilder von Tieren, die Menschen vor Jahrtausenden in die Wand geritzt haben. Das erste zeigt einen Leopard, beinahe einen alten Bekannten, denn wir sind ihm bereits in unserem Reiseführer begegnet. Lauernd hat er zum Sprung angesetzt, deutlich ist das gefleckte Fell zu erkennen. Der Kopf indes fehlt. Vermutlich ist dieser Teil des Felsens irgendwann abgesprengt worden, wie das bei den erheblichen Tag-Nacht-Temperaturunterschieden in der Sahara immer wieder geschieht. Unser Führer zeigt uns ein anderes Bild: die Bubalusse. Wir sind beeindruckt. Zwei stierähnliche Tiere stehen sich (kämpfend?) gegenüber, ihre mächtigen Hörner sind ineinander verschränkt. Hinter einem der beiden Tiere sitzt ein Mensch. Bubalusse waren Verwandte des Wasserbüffels und sind vor rund 5.000 Jahren ausgestorben. Gäbe es sie heute noch, so hätten sie an diesem Ort keine Chance, denn Wasserbüffel brauchen - der Name sagt es - Wasser, und zwar viel. Was vermuten lässt, dass die Bilder zu einer Zeit entstanden, als es in dieser Gegend noch wesentlich mehr davon gab als heute. Und in der Tat - damals, vor rund 10.000 Jahren, sah es hier ebenso wie in der gesamten Sahara ganz anders aus: nicht nur Steine und Sand, wie sie heute diesen Lebensraum dominieren, sondern Bäume und Büsche, Gewässer und Weiden, auf denen die Tiere - und mit ihnen die Menschen - eine Nahrungsgrundlage fanden.

Bilder von Straußen, dann ein Esel, mit wenigen Strichen so modern gezeichnet, dass bei uns der Verdacht entsteht, hier könnten Fälscher am Werk gewesen sein. Witzbolde würden die einen sie nennen, Kulturschänder die anderen. Eine Weile sehen wir uns noch um und fahren dann zurück nach El Ghicha. Wie wir unserem Reiseführer entnommen haben, gibt es in der Nähe weitere Bilder, die wir ebenfalls sehen wollen. Doch das Aushandeln eines Preises für diese zweite Tour endet mit einem Missverständnis, mit der Folge, dass sich unser Führer verabschiedet und wir uns nach einem Nachfolger umsehen müssen. Zwei junge Lehrer bieten sich an. Sie wollen kein Geld, sagen sie, nur ein wenig Konversation auf Französisch und zum Schluss eine Erinnerung an uns, dafür würden sie uns die Bilder gern zeigen. Abermals muss Karin auf die Bretter, diesmal nicht allein, denn nur einer der beiden findet Platz auf dem Beifahrersitz. Nach einer Weile stehen wir vor einer weiteren Felswand. Ein paar Esel in einem gänzlich anderen Stil, dazu, wenn wir uns nicht irren, ein Schakal. In der Nähe zwei Tiere mit hohen gestreiften Beinen, einer geraden Rückenlinie und seltsam herabhängenden Köpfen. Auch diese Bilder sind nicht gemalt, sondern geritzt, und das ist - neben dem trockenen Klima - wohl auch der Grund, weshalb sie sich jahrtausendelang erhalten haben. Erneut stellt sich die Frage, warum Menschen sie in die Felsen graviert haben - jene Frage, die ebenso für alle anderen Abbildungen überall auf der Welt gilt und deren Diskussion inzwischen ganze Bibliotheken füllt. Mit einem Spektrum von Antworten, das von künstlerischen Ambitionen über Fruchtbarkeitsriten, Jagdzauber und Schamanismus bis zu einer Verbindung mit Initiationsriten reicht. Eine spannende Frage, würde ihre richtige Beantwortung doch einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis unserer Vorfahren liefern.
Das Highlight zum Schluss: ein großer Elefant, der mit seinem Rüssel einen kleinen Elefanten vor einem Leoparden schützt. Rund 5.000 Jahre alt ist dieses Bild, aber die Szene ist so anrührend, dass wir auch heute noch emotional darauf reagieren. Ich schütze dich vor der Gefahr, sagt das Bild, und es meint den kleinen, vielleicht gerade erst geborenen Elefanten. Doch die Aussage ist natürlich nicht nur für diese Tierart vorstellbar, sondern ebenso für jede andere. Und auch für Menschen: Ich schütze dich - dich, das Kind, denn überall gibt es Gefahren, die auf dich lauern. Die UNICEF, die Kinderhilfsorganisation der Vereinten Nationen, hat diesen Gedanken aufgegriffen und das Bild von El Ghicha im Jahre 1986 als weltweites Symbol für den Schutz von Kindern gewählt. Ich schütze dich vor der Gefahr - ein Gedanke, der wahrhaft zeitlos ist. Und während wir vor dem Bild stehen und es nachdenklich betrachten, tut sich auf einmal eine Brücke auf zwischen denen, die es einst schufen und uns. Denn obwohl vieles uns trennt, so gibt es doch etwas, das uns über die Jahrtausende verbindet: unser Menschsein.