Das Fadnoun-Plateau.
Unterwegs in einem der lebensfeindlichsten Gebiete der Sahara. Algerien 1990
Unterwegs in einem der lebensfeindlichsten Gebiete der Sahara. Algerien 1990
Illizi ist ein Ort von zunehmender Bedeutung. Im Südosten der algerischen Sahara gelegen, hat sich der ehemalige Stützpunkt der Franzosen nach deren Abzug zu einem wichtigen Verwaltungszentrum der Region entwickelt. Damit zusammenhängend hat die Oase einen kräftigen Aufschwung genommen. Allenthalben finden sich Zeugnisse reger Bautätigkeit, es gibt mehrere Einkaufsmöglichkeiten, eine Post und ein Polizeigebäude, ein Krankenhaus sowie eine Niederlassung der staatlichen Erdölgesellschaft. Und es gibt ein Büro, in dem die Verwaltung des "Parc National du Tassili" residiert, eines ausgedehnten Nationalparks in diesem Teil Algeriens.
Der Mann, der uns hinter seinem Schreibtisch gegenüber sitzt, ist der örtliche Büroleiter dieser Verwaltung. Das meterlange, um sein Gesicht geschlungene Tuch, das lediglich die Augen frei lässt, macht deutlich, dass er dem Volk der Tuareg angehört. Akribisch notiert er unsere Antworten auf seine Fragen in einem dicken Buch: wohin wir wollen, wie lange wir uns im Parc National aufzuhalten gedenken, Angaben zu uns und unserem Fahrzeug. Nachdem er auch noch die Namen unserer Eltern amtlich festgehalten hat, gibt er uns die notwendigen Stempel, wir bezahlen eine Gebühr und besitzen nunmehr die Erlaubnis seiner Behörde zum Besuch des Nationalparks. Doch damit nicht genug - auch die Präfektur sowie die Polizei wollen um ihr Einverständnis gefragt sein. Abermals füllen wir Formulare aus, werden in weitere Bücher eingetragen, und wieder bekommen wir offizielle Stempel. Die ganze Prozedur erweckt den Eindruck, als ginge es um den Erwerb einer Erdölquelle und nicht um eine simple Genehmigung, ein paar Wüstenpisten zu befahren. Einen Vorteil hat dieses Verfahren allerdings: Sollten wir nicht rechtzeitig unser angegebenes Ziel erreichen, so würden sich die Behörden auf die Suche nach uns machen. Doch dieser Fall wird hoffentlich nicht eintreten. An der Tankstelle füllen wir den Tank unseres Wagens noch einmal randvoll, ebenso unsere Ersatzkanister (20 Pfennig kostet ein Liter Diesel), ergänzen unseren Wasservorrat, und dann kann es endlich losgehen. Nachdem wir bisher nur auf Asphaltstraßen gefahren sind, beginnt hinter Illizi die Piste, die uns über Zaouatallaz (das ehemalige Fort Gardel) nach Djanet und weiter nach Tamanrasset führen soll. Eine Strecke von rund tausend Kilometern, nichts als Wellblech, Steine und Sand.

Unser Fahrzeug ist ein VW-Bus, aus Kostengründen einer ohne Vierradantrieb und mit 54 PS überdies die kleinstmögliche Ausführung - ein in früheren Jahren von Wüstenreisenden gelegentlich benutztes Fahrzeug, doch diese Zeiten sind vorbei, da es im Gelände schnell an seine Grenzen stößt. Schon längst haben wir bemerkt, dass wir mit unserem VW-Bus das lahmste Auto der Sahara fahren, nur noch übertroffen von jener Ente, die wir ausgeschlachtet neben einer Piste gesehen haben. Heute sind Geländegängigkeit und PS-Stärke Trumpf, wir hingegen sind beinahe ein Stück Nostalgie.
In südlicher Richtung verlassen wir Illizi. Orientierungsprobleme gibt es hier nicht, die Piste ist durch kleine Sandaufschüttungen an den Rändern nicht schlechter zu erkennen als eine befestigte Straße. Mit der Qualität der Strecke dagegen sieht es ganz anders aus. Bereits nach wenigen Kilometern beginnt jener Teil, über den die Reisenden nach seiner Bewältigung zu sagen pflegen, sie seien froh, ihn glücklich hinter sich gebracht zu haben. Über Steine und Felstreppen führt die Piste zunächst immer höher hinauf, dann geht es abwärts in eine Senke voll Sand, schon für geländegängige Fahrzeuge keine Kleinigkeit, um so mehr für unseren vollbeladenen VW-Bus, der tief liegt und leicht Gefahr läuft aufzusetzen. Schwungvoll, um nicht stecken zu bleiben, durchfahren wir die sandige Senke, gleich darauf folgt harter Grund und der Wagen muss abgebremst werden, um die Reifen nicht an spitzen Steinen aufzuschlitzen. Mehrmals wiederholt sich dieser Wechsel, dann endlich haben wir das Fadnoun-Plateau erklommen. Vor uns erstreckt sich eine hügelige Mondlandschaft, nichts als Steine und Felsen, die im Licht der schräg stehenden Sonne glänzen. Liebhaber der Farbe Schwarz kommen hier voll auf ihre Kosten. Das Fadnoun-Plateau ist eine der am wenigsten belebten Regionen der Sahara. Hier gibt es keine Oasen, hier ziehen keine Nomaden mit Ziegen und Schafen umher, dieses Plateau ist eine der lebensfeindlichsten Landschaften, die wir jemals kennen gelernt haben. Aber gleichzeitig ist es eine der faszinierendsten.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
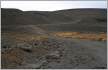 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Das Fahren auf der Piste ist eine Frage des Fingerspitzengefühls, das wir uns als Anfänger erst erarbeiten müssen. Der dominierende Gang unseres Autos ist der erste. Langsam, sehr langsam rollt der Wagen über die Piste, er ächzt und stöhnt, und wenn er auf Wellblech trifft - eine Verdichtung des Bodens, die mit dem Wort anschaulich beschrieben ist -, dann beginnt er zu klappern. Schlimmer für uns sind indes die Felstreppen, bei denen wir Gefahr laufen aufzusetzen. Nicht ohne Neid blicken wir den wenigen anderen Fahrzeugen nach, denen wir auf dem Plateau begegnen - vierradgetrieben, hoch gelagert, mit dicken Reifen, denen kein Stein so schnell etwas anhaben kann und die über PS-Stärken verfügen, von denen wir nur träumen können. Besser dran als wir sind auch die wenigen LKWs, die uns unterwegs überholen. Ihre Fahrer sind Tuareg, die in den Oasen des Nordens eingekauft haben und die nun auf der Rückfahrt zu ihren Familien sind. Neben unserem Auto halten sie an, Gelegenheit für eine kurze Konversation und für eine rudimentäre "ärztliche Hilfe": ein paar Kopfschmerztabletten und ein Verband um einen entzündeten Finger. Wie so oft bei unserem Algerienaufenthalt endet die Konversation mit der Frage, ob wir Geld tauschen oder Alkohol verkaufen wollten. Beides wollen wir nicht. Es ist verboten bzw. unerwünscht, obwohl selbst die algerische Polizei vor derlei Fragen nicht zurückschreckt.
Da es Januar ist, sind die Tage kurz, doch hat diese Jahreszeit den Vorteil, dass die Temperatur 25°C während des Tages nicht überschreitet. Rund zehn Stunden sind wir täglich unterwegs, wobei der abendliche Blick auf unseren Kilometerzähler die Bestätigung liefert, dass wir tatsächlich nur im Schneckentempo vorankommen. Am dritten Tag steht neben der Piste ein Schild mit der Aufschrift "Danger!", danach geht es steil abwärts, unbefestigt natürlich, eine einzige Schaukelei am Abgrund entlang. Ausgeschlachtete Autowracks tief unter uns bezeugen, wie berechtigt das Schild ist. Es folgt ein Oued, ein Flusstal aus früheren Zeiten, als die Gegend noch fruchtbar war. Vereinzelt treffen wir auf Bäume und Büsche, die in dieser Umgebung fast schon den Eindruck üppiger Vegetation hervorrufen. Dann geht es wieder steil aufwärts bis in eine Höhe von 1.500 m. Riesige Steinblöcke auf Hügelkämmen erwecken den Eindruck, als würden Armeen von Riesen gegeneinander aufmarschieren. Es ist eine Landschaft, deren Faszination sich wohl kein Reisender entziehen kann. Im übrigen macht sie einmal mehr deutlich, dass die Sahara mitnichten jener riesige Buddelkasten voller Sand ist, als den manche sich diese größte Wüste der Erde noch immer vorstellen.

Gibt es auf dem Fadnoun-Plateau auch nur wenig Leben, so heißt das nicht, dass es überhaupt keines gäbe. Kaum haben wir uns einen Platz für die Nacht gesucht, als einige Vögel erscheinen, Wüstenraben zunächst, später solche, die wie Wollknäule aussehen. Einmal erblicken wir auf unserer Fahrt Gazellen, später Murmeltiere, dann auch Kamele. Wo diese Tiere sind, muss es Wasser geben, sagen wir uns. Und tatsächlich stoßen wir dreimal auf Gueltas - Wasserlöcher, die durch Felswände so gut vor der Sonne geschützt sind, dass sie nicht austrocknen. Was für ein Bild: kleine Wellen, die der Wind über die Wasseroberfläche treibt, üppig grünende Oleanderbüsche ringsum, dazu Spuren von Menschen und Tieren, die diese Orte aufgesucht haben.
Was einem auf dem Fadnoun-Plateau zustoßen kann, sehen wir am Mittag des dritten Tages. Ein VW-Bus, ein Jahr alt, Vierradantrieb, steht neben der Piste. Der Kühlwasserbehälter ist zerschlagen, die Lichtmaschine defekt, und das rund 100 km vor der nächsten Oase. Was die Sache für den Fahrer besonders ärgerlich macht, ist die Angst vor Schadensersatz: Es handelt sich um einen Reiseveranstalter, der mit einem Dutzend Motorradfahrer unterwegs ist. Sie genießen die "Freiheit der Wüste", er transportiert ihr Gepäck. Oder richtiger: er transportierte ...
Einen Höhepunkt auf der Strecke bilden die Felsgravuren von Tinterhert. Ohne lange zu suchen, finden wir den Abzweig von der Piste, wir brauchen bloß den Spuren anderer Fahrzeuge zu folgen. Wenige Kilometer später glauben wir zu träumen: Vor uns steht ein Schild, das uns darauf aufmerksam macht, dass die Besichtigung der Gravuren nur mit einer offiziellen Genehmigung aus Illizi oder Zaouatallaz möglich sei. Außerdem müssten die Besucher einen Führer nehmen. Und siehe da: Kaum haben wir das Schild gelesen, da steht auch schon ein solcher Führer vor uns, ein Targi (Singular von Tuareg - ML), der ganz in der Nähe in einem Zelt lebt. 100 Dinar koste die Besichtigung der Gravuren, erklärt er, das sind nach offiziellem Kurs stolze 25 DM. Wir versuchen, den Preis zu drücken, doch er kontert mit der Aufforderung, wir mögen ihm doch bitte unsere schriftliche Genehmigung für die Besichtigung der Bilder zeigen. Wir zahlen. Im nächsten Augenblick sitzt er im Auto, auf dem Beifahrersitz natürlich, denn Karin ist eine Frau und deshalb muss sie nach hinten zum Gepäck. Das Thema Genehmigung - versteht sich - ist keines mehr. Nach einer kurzen Fahrt stehen wir vor einer großen Felsplatte voller Gravuren: Giraffen, Antilopen, Strauße sowie menschliche Figuren, vor allem aber die berühmte, fünf Meter lange Kuh, die Menschen vor Tausenden von Jahren in diese Felsplatte geritzt haben. Schlimm nur, dass Touristen selbst an diesem abgelegenen Ort bereits Schäden angerichtet haben.

Noch mehr Felsen und Sand, danach eine weitere steile Abfahrt, schließlich endet die Strecke so, wie sie begonnen hat: bürokratisch. Müde wischt sich der Polizist in Zaouatallaz den Schlaf aus den Augen, als wir am Morgen des vierten Tages in seinem Dienstgebäude erscheinen. Er führt uns in ein karg möbliertes Zimmer, prüft unsere Pässe und trägt uns in ein Buch ein, die amtliche Feststellung, dass wir den ersten Teil unserer genehmigten Strecke im "Parc National du Tassili" geschafft haben. Danach dürfen wir weiterfahren, nachdem der Polizist uns zuvor noch ein paar Liter aus dem Wasservorrat seiner Behörde geschenkt hat. Ein noch größeres Geschenk wird uns allerdings kurz hinter der Oase zuteil, als neben uns ein Landrover anhält und der Fahrer erkennbar genervt beteuert, schon sechs mal sei er in der Sahara gewesen, aber eine solch fürchterliche Strecke wie dieses Fadnoun-Plateau habe er noch nie kennen gelernt. Und er fügt hinzu: eine solche Strecke wolle er auch nie wieder kennen lernen. Wir haben Mühe, uns unseren Anfängerstolz nicht anmerken zu lassen ...





