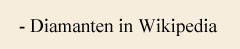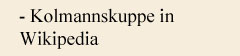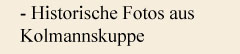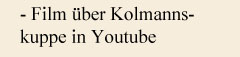Schätze im Sand.
Diamanten machten Kolmannskuppe einst zum reichsten Ort Afrikas. Namibia 2012
Diamanten machten Kolmannskuppe einst zum reichsten Ort Afrikas. Namibia 2012
Alles begann damit, dass der Thüringer August Stauch an Asthma litt. Stauch war Angestellter der Reichsbahn, und als seine Atembeschwerden heftiger wurden - das war im Jahr 1907 und Stauch zählte damals knapp 30 Jahre -, riet ihm sein Arzt, sich für einige Zeit nach Deutsch Südwestafrika versetzen zu lassen. Dort, so erklärte er ihm, sei das Klima ideal und eine Besserung seiner Krankheit sei zu erwarten. Stauch sagte Frau und Kindern Lebewohl und schiffte sich in jene als "Schutzgebiet" deklarierte afrikanische Kolonie ein (das heutige Namibia), die seit 1883 zum deutschen Kaiserreich gehörte (siehe Bericht 037). Sein neuer Arbeitplatz lag mitten in der Namibwüste, aber er hätte auch ebenso gut im Vorhof der Hölle liegen können. Die Namib ist eine der lebensfeindlichsten Wüsten der Erde, es gibt nur Sand und Felsen und dazu einen stürmischen Wind, der beinahe täglich über das Land fegt. Der Arbeitsplatz, den man Stauch zugeteilt hatte, trug den Namen Grasplatz, aber dieser Name war ein Witz, denn Gras gab es hier nirgends. Grasplatz war eine Station an der Bahnstrecke von Windhouk nach Lüderitz am Atlantik, und die Aufgabe Stauchs bestand darin, rund zwanzig Kilometer dieser Strecke frei von Verwehungen zu halten. Mit dem Pflichtbewusstsein eines deutschen Beamten stemmte er sich den Naturgewalten entgegen, ein thüringischer Sisyphos gewissermaßen, doch da auch das Pflichtbewusstsein seine Grenzen hat und der Weg zum Verrücktwerden in dieser Umgebung nur ein sehr kurzer war, begann er sich mit etwas zu beschäftigen, was es in dieser gottverlassenen Gegend neben dem Sand am reichlichsten gab: mit Mineralien aller Art, mit Steinen. Entsprechend aufgeschlossen war er, als sein schwarzer Hilfsarbeiter Zacharias Lewala ihm am 14. April des Jahres 1908 mit den Worten "Sieh mal, Mister, ein schöner Stein!" einen Fund brachte. Stauch begutachtete den Stein und erkannte ihn als einen lupenreinen Diamanten. Um den ersten von einer schier endlosen Zahl, die in dieser Gegend folgen sollten.

Wir kommen von Lüderitz her, eine etwa zehn Kilometer lange Fahrt durch die Wüste, bis wir hinter einem Schleier von aufgewehtem Sand die ersten Häuser erblicken. An einem Hinweisschild biegen wir von der Hauptstraße ab und halten ein paar hundert Meter weiter vor einem großen Gebäude. Als wir aus dem Auto steigen, reißt uns der Wind beinahe die Türen aus der Hand. Wie selbstverständlich richten wir unsere ersten Blicke nach unten in den Sand. Hier also war es, woher die Berichte stammten, die sich anhörten, als seien sie Märchen. So zahlreich wie Pflaumen unter einem Pflaumenbaum hätten die Diamanten hier gelegen, heißt es in einem. Und ein anderer erzählt, wie Stauch einst am Boden sitzend gleich 37 Diamanten auf einmal gefunden habe, alle in seiner Reichweite. Verständlich, dass solche Berichte Aufsehen erregten, und die deutsche Regierung reagierte denn auch prompt. Kurzerhand erklärte sie einen Küstenstreifen von 100 mal 300 km zum Sperrgebiet - ein solches gibt es noch heute - und beauftragte eine deutsche Gesellschaft mit der Ausbeutung der Vorkommen. Innerhalb kürzester Zeit wuchs an dem Ort der Diamantenfunde eine Siedlung aus dem Sand - Kolmannskuppe, oder wie die Siedlung auf Afrikaans hieß: Kolmanskop.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Die Führung, an der wir teilnehmen, findet auf Deutsch statt, ein Schwarzer in der Sprache, die in dieser einstigen deutschen Kolonie Tradition hat. Entschlossen kämpfen wir uns hinter ihm her durch den Sand und den Wind und lauschen seinen Worten. Und je länger wir mit ihm unterwegs sind und je mehr wir erfahren, um so mehr geraten wir ins Staunen. Lag Kolmannskuppe mit seinen rund 400 weißen und 800 schwarzen Bewohnern auch in einer der unwirtlichsten Gegenden unseres Planeten, so war es zugleich ein Ort, an dem es an nichts fehlte. Was gebraucht wurde, war vorhanden - angefangen bei Einrichtungen wie einer Bäckerei und einer Metzgerei über eine Großküche, ein Postamt, das die Verbindung zur Heimat sicher stellen sollte, eine Polizeistation für die Aufrechterhaltung der Ordnung bis hin 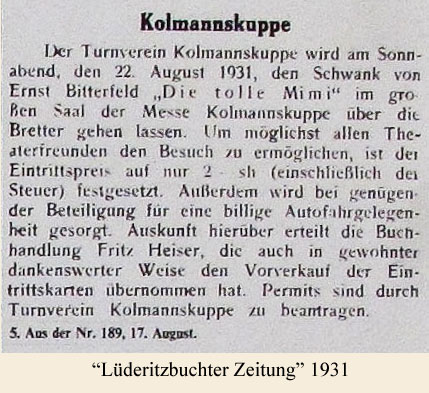 zu einem eigenen Elektrizitätswerk für die Beleuchtung der Wege und der Häuser, darunter nicht zuletzt eines Krankenhauses, das es hier ebenfalls gab und das sogar über einen eigenen Röntgenapparat verfügte, den ersten nicht nur in Afrika, sondern in der gesamten südlichen Hemisphäre. Eine Schmalspurbahn zum Transport von Personen und Waren verband die einzelnen Teile der Siedlung miteinander, in einem (mit Atlantikwasser gefüllten) Schwimmbecken konnten Schwitzende Abkühlung suchen. Als ein Problem erwies sich die Versorgung mit Trinkwasser. Da es natürliche Vorkommen in dieser Gegend nicht gab, schaffte man Wasser aus dem rund 1.000 km entfernten Kapstadt herbei, zunächst per Schiff übers Meer, danach auf Schlitten, die von Maultieren durch den Sand gezogen wurden. Pro Tag bekam jeder Bewohner der Siedlung 20 Liter kostenlos zur Verfügung, dazu erhielt jede Familie täglich einen halben Block Eis aus einer eigenen Fabrik zwecks Kühlung der Lebensmittel. In einer liebevoll eingerichteten Ausstellung in einem der Gebäude sind Fotos der damaligen Bewohner zu sehen. Wüsste man nicht, wo diese Fotos entstanden - es könnte in jeder beliebigen Stadt in Deutschland gewesen sein. Die Bilder von der Kapelle etwa, die zum Tanz aufspielte, die Männer beim Sport in der Turnhalle, die Jungen und Mädchen des Kindergartens, die Kegelbrüder des Klubs "Gut Holz" auf ihrer Bahn oder die große Bühne, die für feierliche Anlässe und Theatervorstellungen genutzt wurde und dem Gesangsverein für seine Auftritte diente.
zu einem eigenen Elektrizitätswerk für die Beleuchtung der Wege und der Häuser, darunter nicht zuletzt eines Krankenhauses, das es hier ebenfalls gab und das sogar über einen eigenen Röntgenapparat verfügte, den ersten nicht nur in Afrika, sondern in der gesamten südlichen Hemisphäre. Eine Schmalspurbahn zum Transport von Personen und Waren verband die einzelnen Teile der Siedlung miteinander, in einem (mit Atlantikwasser gefüllten) Schwimmbecken konnten Schwitzende Abkühlung suchen. Als ein Problem erwies sich die Versorgung mit Trinkwasser. Da es natürliche Vorkommen in dieser Gegend nicht gab, schaffte man Wasser aus dem rund 1.000 km entfernten Kapstadt herbei, zunächst per Schiff übers Meer, danach auf Schlitten, die von Maultieren durch den Sand gezogen wurden. Pro Tag bekam jeder Bewohner der Siedlung 20 Liter kostenlos zur Verfügung, dazu erhielt jede Familie täglich einen halben Block Eis aus einer eigenen Fabrik zwecks Kühlung der Lebensmittel. In einer liebevoll eingerichteten Ausstellung in einem der Gebäude sind Fotos der damaligen Bewohner zu sehen. Wüsste man nicht, wo diese Fotos entstanden - es könnte in jeder beliebigen Stadt in Deutschland gewesen sein. Die Bilder von der Kapelle etwa, die zum Tanz aufspielte, die Männer beim Sport in der Turnhalle, die Jungen und Mädchen des Kindergartens, die Kegelbrüder des Klubs "Gut Holz" auf ihrer Bahn oder die große Bühne, die für feierliche Anlässe und Theatervorstellungen genutzt wurde und dem Gesangsverein für seine Auftritte diente.
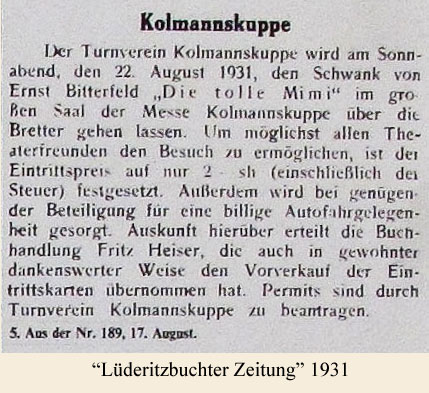 zu einem eigenen Elektrizitätswerk für die Beleuchtung der Wege und der Häuser, darunter nicht zuletzt eines Krankenhauses, das es hier ebenfalls gab und das sogar über einen eigenen Röntgenapparat verfügte, den ersten nicht nur in Afrika, sondern in der gesamten südlichen Hemisphäre. Eine Schmalspurbahn zum Transport von Personen und Waren verband die einzelnen Teile der Siedlung miteinander, in einem (mit Atlantikwasser gefüllten) Schwimmbecken konnten Schwitzende Abkühlung suchen. Als ein Problem erwies sich die Versorgung mit Trinkwasser. Da es natürliche Vorkommen in dieser Gegend nicht gab, schaffte man Wasser aus dem rund 1.000 km entfernten Kapstadt herbei, zunächst per Schiff übers Meer, danach auf Schlitten, die von Maultieren durch den Sand gezogen wurden. Pro Tag bekam jeder Bewohner der Siedlung 20 Liter kostenlos zur Verfügung, dazu erhielt jede Familie täglich einen halben Block Eis aus einer eigenen Fabrik zwecks Kühlung der Lebensmittel. In einer liebevoll eingerichteten Ausstellung in einem der Gebäude sind Fotos der damaligen Bewohner zu sehen. Wüsste man nicht, wo diese Fotos entstanden - es könnte in jeder beliebigen Stadt in Deutschland gewesen sein. Die Bilder von der Kapelle etwa, die zum Tanz aufspielte, die Männer beim Sport in der Turnhalle, die Jungen und Mädchen des Kindergartens, die Kegelbrüder des Klubs "Gut Holz" auf ihrer Bahn oder die große Bühne, die für feierliche Anlässe und Theatervorstellungen genutzt wurde und dem Gesangsverein für seine Auftritte diente.
zu einem eigenen Elektrizitätswerk für die Beleuchtung der Wege und der Häuser, darunter nicht zuletzt eines Krankenhauses, das es hier ebenfalls gab und das sogar über einen eigenen Röntgenapparat verfügte, den ersten nicht nur in Afrika, sondern in der gesamten südlichen Hemisphäre. Eine Schmalspurbahn zum Transport von Personen und Waren verband die einzelnen Teile der Siedlung miteinander, in einem (mit Atlantikwasser gefüllten) Schwimmbecken konnten Schwitzende Abkühlung suchen. Als ein Problem erwies sich die Versorgung mit Trinkwasser. Da es natürliche Vorkommen in dieser Gegend nicht gab, schaffte man Wasser aus dem rund 1.000 km entfernten Kapstadt herbei, zunächst per Schiff übers Meer, danach auf Schlitten, die von Maultieren durch den Sand gezogen wurden. Pro Tag bekam jeder Bewohner der Siedlung 20 Liter kostenlos zur Verfügung, dazu erhielt jede Familie täglich einen halben Block Eis aus einer eigenen Fabrik zwecks Kühlung der Lebensmittel. In einer liebevoll eingerichteten Ausstellung in einem der Gebäude sind Fotos der damaligen Bewohner zu sehen. Wüsste man nicht, wo diese Fotos entstanden - es könnte in jeder beliebigen Stadt in Deutschland gewesen sein. Die Bilder von der Kapelle etwa, die zum Tanz aufspielte, die Männer beim Sport in der Turnhalle, die Jungen und Mädchen des Kindergartens, die Kegelbrüder des Klubs "Gut Holz" auf ihrer Bahn oder die große Bühne, die für feierliche Anlässe und Theatervorstellungen genutzt wurde und dem Gesangsverein für seine Auftritte diente.Schwarze - in der damaligen Terminologie: Neger - sieht man auf den ausgestellten Bildern eher selten, und wenn, dann bei der Arbeit. Sie waren es, die in der Gluthitze Löcher in den Boden gruben und Tausende und Abertausende Tonnen Sand nach Diamanten durchsiebten, auf ihren Schweiß und ihre Gesundheit gründete sich der Reichtum von Kolmannskuppe, der den Ort für die Dauer einiger Jahrzehnte zum reichsten Ort Afrikas machte. Rund fünf Millionen Karat haben die Arbeiter allein in den Jahren von 1908 bis 1913 aus dem Sand gegraben, fast eine Tonne und den fünften Teil der damaligen weltweiten Fördermenge. Dass diese Reichtümer auch kriminelle Energien freisetzen mussten, liegt auf der Hand. Und so ist die Geschichte von Kolmannskuppe auch ein Zeugnis für die beeindruckenden Fähigkeiten des menschlichen Verstandes, wenn es darum ging, sich auf illegale Weise zu bereichern. Etliche Bewohner der Siedlung hatten ein solches Vorgehen allerdings gar nicht nötig, hatten sie sich doch mittels günstiger Verträge äußerst großzügige Einkommen zugeschanzt. "Dort drüben", sagt der Führer unserer Gruppe und deutet in eine Richtung, "befinden sich die Häuser der damaligen leitenden Angestellten, wie man diese Leute heute nennen würde. Gehen Sie hinein und schauen Sie sich um!"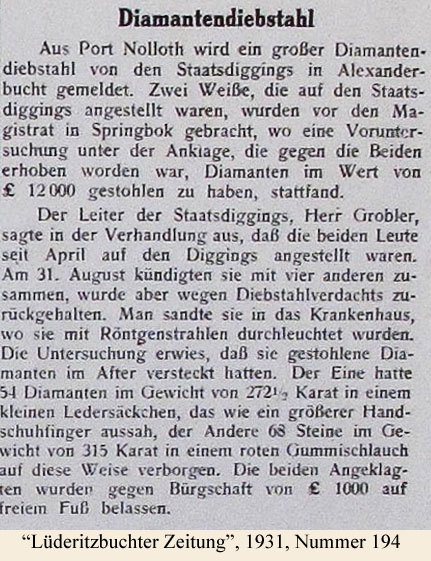
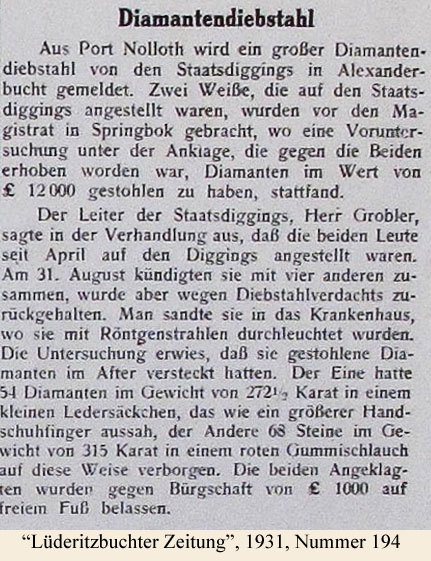
Abermals stemmen wir uns gegen den Wind und stapfen durch den Sand zu den Häusern, die sich durch Größe und Architektur von den anderen abheben und die selbst noch in den prominenten Ortsteilen von Berlin, Hamburg oder München die anerkennenden Blicke der Passanten auf sich gezogen hätten. Neugierig erkunden wir die Räume, und obwohl alle leer sind - museal möblierte Räume finden wir anschließend in einem anderen Gebäude -, vermittelt die geräumige Anlage der Häuser doch einen guten Eindruck von dem Lebensstil ihrer Bewohner. Hier also waren die Herren der Diamanten zu Hause, hier haben sie gearbeitet, gespeist und geliebt, in diesen Wänden haben sie sich beim Kartenpiel vergnügt, haben geraucht und getrunken, und hier haben sie, wenn der Abend anbrach, mit Freunden auf der Veranda gesessen. Auf jenem hölzernen Vorbau, der damals natürlich ganz anders aussah als heute, wertvolle Möbel und weiche Teppiche, gestickte Decken auf den Tischen und Palmen in Porzellankübeln, und in kristallenen Karaffen gut gekühlte Weine von der Mosel, so jedenfalls stellen wir uns das Leben der damaligen Bewohner vor. Nur ihr Ausblick von der Veranda war derselbe, den auch wir heute noch haben: auf eine Landschaft, so einsam und hart und von solch kompromissloser Feindseligkeit, dass sie gewiss manch einen der damals hier Lebenden in die Verzweiflung getrieben hat.

Es war gegen Ende der 1920er Jahre, als der Niedergang von Kolmannskuppe begann. Die Diamantenfelder waren erschöpft, und die Schürfer machten sich auf die Suche nach neuen Fundstätten. So schnell, wie die Siedlung aus der Retorte entstanden war, so schnell ging sie auch wieder verloren, und die Namibwüste machte sich daran, dass verlorene Terrain zurückzuerobern. Über Jahrzehnte verfiel der Ort. Das Vorhandene wurde geplündert, und in die Häuser kroch unaufhaltsam der Sand. In den 1990er Jahren setzte ein Umdenken ein. Man begann sich wieder an Kolmannskuppe zu erinnern, erhielt, was zu erhalten war, restaurierte, was sich wiederherstellen ließ und richtete schließlich einen Museumsbetrieb ein. Heute ist Kolmannskuppe ein spannendes Zeugnis für die Geschichte des Landes, überdies als eine Geisterstadt inmitten der Wüste ein faszinierender Ort für Fotografen. August Stauch, der Mann, der am Anfang dieser Entwicklung stand, war in den 1990er Jahren längst tot. Als ein reicher Mann war er bereits 1924 aus dem Diamentengeschäft ausgestiegen, verlor aber schon wenig später in der Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jahre fast sein gesamtes Vermögen. Sein Leben beendete er 1947 in dem kleinen thüringischen Ort, aus dem er einst aufgebrochen war - verarmt.
(Zum Thema Diamanten siehe auch meinen Bericht 32: "Schätze in Schachteln. Der Diamond Jewelry Way in New York. 2010")