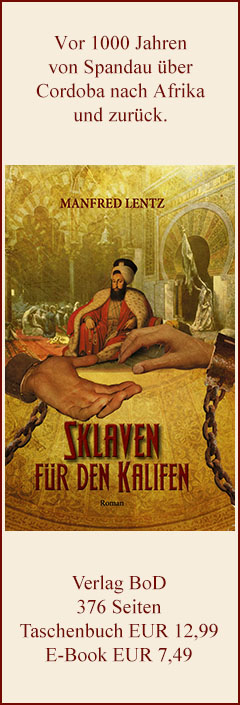Grünes Gold
Beim Tee gehört das kleine Sri Lanka zu den ganz Großen. 2013 (Teil 1)
Beim Tee gehört das kleine Sri Lanka zu den ganz Großen. 2013 (Teil 1)
Transzendente Erfahrung oder weichgespülter Schwachsinn, was der Dichter Lo Tung aus der Tang-Dynastie da über den Tee schreibt? "Die erste Tasse netzt mir die Lippen", beginnt er seine Ausführungen, und gegen diesen Satz ist schwerlich etwas zu sagen. Doch dann geht es los: "Die zweite verscheucht meine Einsamkeit. Die dritte durchdringt mein unfruchtbares Inneres ... Bei der fünften bin ich geläutert. Die sechste ruft mich ins Reich des Unvergänglichen. Die siebente - Oh, ich kann nicht weitertrinken ..." Was ich gut nachvollziehen kann, denn nach sechs Tassen könnte ich auch nicht weitertrinken, selbst wenn ich in Rechnung stelle, dass Lo Tungs Tassen vermutlich kleiner waren als meine. Aber so banal meint der Dichter das natürlich nicht. Seine Gedanken bewegen sich in einer ganz anderen Dimension, und deshalb fährt er fort: "... ich fühle nur den kalten Windhauch, der sich in meinen Ärmeln fängt. Lasst mich in diesem lieblichen Windhauch segeln und mitschweben." Nun ja - wenn ich Tee trinke, dann ist das ganz anders. Viel profaner. Der Tee schmeckt, er wärmt, und was ich ganz besonders an ihm schätze: Er hat tausend Gesichter. Tee gibt es grün, schwarz und halbfermentiert, es gibt ihn in Abstufungen von hauchzart bis kräftig, ich kann ihn mit Zucker, Sahne oder Zitrone trinken, und außerdem ist da noch eine endlose Reihe aromatisierter Versionen: Mandel und Kirsch, Erdbeere und Rhabarber, ja selbst den Geschmack von Schlagsahne hat die moderne Chemie in ihrer Trickkiste. Nicht zu vergessen die geräucherten Sorten wie der Lapsang Souchong oder die tibetischen Teeziegel, die man sowohl in ein Getränk verwandeln als auch zu Dekorationszwecken ins Regal stellen kann. Tausend Gesichter hat der Tee also - aber dass mich auch nur eine dieser Sorten geläutert oder ins Reich des Unvergänglichen gerufen hätte? Doch sei's drum, lieber Dichter Lo Tung - bei allen Unterschieden haben wir doch eines gemeinsam: die Liebe zum Tee.

Im Jahr 2013 sind wir auf Sri Lanka, also dort, wo der Tee herkommt. Nicht sämtlicher auf der Welt getrunkene Tee, versteht sich. Aber nach China, Indien und Kenia ist die Insel der viertgrößte Produzent, und was den Export anbelangt, so liegt sie mit rund 300.000 Tonnen pro Jahr mit dem Riesenland China in etwa gleichauf. Sri Lanka-Tee? Nein, natürlich nicht, unter diesem Namen ist er in keinem Geschäft erhältlich. Nach Ceylon-Tee muss man fragen. Ceylon ist der alte Name des heutigen Sri Lanka. War es für kolonisierte Völker nach Erlangung der Unabhängigkeit auch immer wichtig, die ihnen während der Fremdherrschaft von den Kolonialmächten oktroyierten Namen für ihre Länder gegen eigene einzutauschen, so lässt man diese Epoche in Bezug auf den Tee auf Sri Lanka ganz bewusst weiterleben. Ceylon war die Marke, die es in der Vergangenheit zu weltweitem Ansehen gebracht hatte, und deshalb füllt der Tee von der Insel unter diesem Namen auch heute noch die Regale. Eine kluge Entscheidung, ist dieser Wirtschaftszweig doch der größte Arbeitgeber im Land und der Tee mit einem Anteil von rund 60 Prozent an den gesamten Exporterlösen das Produkt Nummer eins. Angebaut wird das grüne Gold ausschließlich im Inneren der Insel, an ihren Rändern würde man vergeblich danach suchen. Camillia sinensis - so der lateinische Name der Pflanze - benötigt für ihr Gedeihen kühle Temperaturen und häufigen Regen, und genau diese Bedingungen findet sie im Hochland. In Lagen zwischen 1500 und 2200 Metern, wo die vom Meer herantreibenden Wolken sich an den Bergen abregnen. So wie in der Gegend um Nuwara Eliya.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
Der 18-Loch-Golfplatz der kleinen Stadt gilt als einer der schönsten in Asien. Es gibt eine Pferderennbahn, eine Formel 3-Autorennstrecke und ein Postgebäude aus rotem Backstein, dazu Hotels und andere Bauten, die man im südenglischen Hampshire oder in den schottischen Highlands erwarten würde, aber nicht hier. Dieses Aussehen, das Nuwara Eliya von allen anderen Städten Sri Lankas unterscheidet, ist dem Umstand zu verdanken, dass die britischen Beamten während der Kolonialzeit die heißen Monate des Jahres lieber auf angenehmen 1900 Metern verbrachten als auf Meereshöhe, wo ihnen das schwül-heiße und malariaverseuchte Klima zu schaffen machte. Für uns ist die höchstgelegene Stadt Sri Lankas Ausgangspunkt einer dreistündigen Bahnfahrt durch eine der schönsten Landschaften der Insel (in Bericht 88 und Bericht 89 habe ich sie geschildert). Wälder mit tropischen Gehölzen wechseln mit Bananenplantagen und Gemüsefeldern, es gibt tiefe Schluchten und malerische Wasserfälle und dazwischen wie dicke grüne Teppiche Tee, Tee und nochmals Tee. Angepflanzte Bäume inmitten der Plantagen sollen den jungen Blättern ein wenig Schatten spenden, gleichzeitig sind sie ein Schutz gegen die Bodenerosion während des Monsuns, wenn das Wasser wie aus Eimern vom Himmel fällt.

Tee ohne Ende also, und dabei hätte Sri Lanka eigentlich eine Kaffeeinsel sein sollen. Kaum hatten die Briten zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Herrschaft über das Land errungen, als Neusiedler begannen, Urwald zu roden und Kaffee anzubauen, da dessen Ausfuhr ins Mutterland reiche Profite versprach. Zunächst lief alles bestens, bis im Jahr 1869 ein Schreckgespenst namens Hemileia vastatrix auf der Insel erschien. Ein Pilz, der nicht nur binnen kurzem große Teile der Ernte vernichtete, sondern der darüber hinaus den weiteren Anbau von Kaffee zu einem risikoreichen Geschäft machte. Als Folge dieser dramatischen Situation warfen die Plantagenbesitzer das Ruder herum und begannen mit dem Anbau von Tee, der im Hochland die erwähnten optimalen Bedingungen vorfand. Produziert wurde vornehmlich schwarzer Tee, der den europäischen Trinkgewohnheiten besser entsprach als der damals hauptsächlich verbreitete grüne aus China. Wobei - das sei für diejenigen gesagt, die sich mit Tee eher weniger auskennen - es sich bei beiden Sorten um dieselbe Pflanze handelt, lediglich die Verarbeitung der Blätter ist unterschiedlich. Als Arbeitskräfte auf den neuen Plantagen wurden vor allem jene Tamilen aus dem nahegelegenen Südindien eingesetzt, die man ursprünglich für den Anbau von Kaffee ins Land geholt hatte, und auch der Bedarf an zusätzlichen Kräften wurde im Nachbarland gedeckt. Indische Tamilen bilden bis heute das Rückgrat der sri lankischen Teeindustrie, wobei es allerdings nicht die Topjobs sind, in denen man die Angehörigen dieser Volksgruppe findet. Dort, wo die Einkünfte am höchsten sind und die Arbeit moderat ist, sitzen andere. Die Tamilen sind nach wie vor diejenigen, die die anstrengendsten und zugleich am schlechtesten bezahlten Arbeiten erledigen. Was vor allem auf die Frauen zutrifft, die das ganze Jahr über auf den Plantagen im Dauereinsatz sind. Die Pflückerinnen.
(Wird fortgesetzt)
Manfred Lentz (Juli 2016)
Die neuen Berichte auf reiselust.me erscheinen jeweils
am 1. und 15. jedes Monats